TODES-ANGST

von Tobias Prüwer
„Ich besitze jetzt ein neues schwarzes Hemd und meine erste Fliege. Ich hasse Beerdigungen. Der Tod ist ein Arschloch!“ (25.01.2020)
Zwischen die Zusage für diesen Text und dem Verfassen des obigen Twitter-Tweets platzten zwei Tode. Eigentlich wollte ich aufschreiben, wie ein Tod vor zehn Jahren mich aus der Bahn warf. Damals starb mein Zieh- oder Zweitvater – der neue Mann meiner Mama – ebenfalls um Neujahr herum. Es war nicht meine erste Beerdigung, aber die bisher heftigste. Und auch jene, die mich um meiner selbst willen am derbsten anging. Denn in die tiefe Trauer mischte sich buchstäblich Todesangst.
Ich konnte nicht einschlafen, weil mich die Furcht vorm Ableben marterte. Die Unvorstellbarkeit meiner eigenen Nichtexistenz raubte mir den Schlaf. Oder ich redete mir das wenigstens ein – sodass ich zum Gewohnheitstrinker wurde. Was ist schon falsch an einem „Gute-Nacht-Bier“? Oder mehreren …
Die Häufung von Beerdigungen macht die Erfahrung keinesfalls besser. Das weiß ich nun auch. Und mit Fliege sehe ich nicht wirklich schicker aus. Schön trinken kann man sich den Exitus auch nicht, aber besser verdrängen. Es ist natürlich der Verlust der Lieben, der den Tod zum Arschloch für die Lebenden macht. Denn die Toten fehlen uns, reißen Lücken in Familien und Freundeskreise. Darum dreht sich ja auch die Vielzahl der Totenrituale, bei denen das alkoholische Verdrängen auch gesellschaftlich legitimiert ist. Schlaumeier wenden immer ein, dass man gar keine Furcht haben kann vor dem, was man nicht kennt. Dann wird Sokrates mit der berühmten Stelle zitiert, nach der er ohne Angst den giftigen Schierlingsbecher die Kehle runterstürzt – wie ich meine „Gute-Nacht-Biere“ –, dass man vor dem Ungewissen gar keine Angst zu haben braucht. „Aber schon ist es Zeit, dass wir gehen – ich um zu sterben, ihr um zu leben: Wer aber von uns den besseren Weg beschreitet, das weiß niemand, es sei denn der Gott.“ Oder man wird ermahnt, dass es dann egal sei, weil man ohnehin nichts mehr mitbekommt. Und dann wird auf die Spielarten der Hochkultur verwiesen, irgendwie mit dem Unausweichlichen umzugehen.
„Komm o Tod, du Schlafes Bruder.“
Übrigens war Sokrates‘ Ableben wenig angenehm. Im Spiegel beschrieb mal ein Gerichtsmediziner die Wirkung des Schierlings: „Das ist eine äußerst widerwärtige Art zu sterben: Ein Gramm führt innerhalb von 30 Minuten zum Tod. Es erfolgt eine Paralyse der motorischen und sensiblen Nervenenden sowie des Rückenmarks. Am Ende wird bei vollem Bewusstsein die Atemmuskulatur gelähmt.“ Das zum Thema schmerz- und angstlos Sterben.
Ja, auf viele Weisen wird die Todesangst eingehegt. Wenn man sich nur bewusst umschaut, wird man überall an Schlafes Bruder erinnert. Das soll sicherlich kulturell beruhigend wirken. Als Beispiel kann der Hinweis auf die Rathäuser meiner Wahlheimat Leipzig genügen. Der Tod lauert am Alten Rathaus. Ein Stundenglas schwenkt das Skelett, das einem Ausrufer mit Horn am Mund folgt. „Wir werden alle sterben“, verkündet das gegenüber der Mädlerpassage befindliche Detail. „MORS CERTA, HORA INCERTA“, sekundiert ein Schriftzug am Neuen Rathaus: „Der Tod ist gewiss, die Stunde ungewiss.“ Sterben und Tod mögen etwas aus dem öffentlichen Bewusstsein gerückt sein. Wessen Blick die Bauelemente streift, der wird unverhofft mit der eigenen Endlichkeit konfrontiert.
Mir helfen solche Verweise auf die Kultur, darauf, dass wir alle mal gehen müssen, und auch jedes Memento herzlich wenig. Dann liege ich nachts wach, habe Herzrasen, verspüre Panik, bekomme den quälenden Gedanken nicht weg. Eine bessere Rechtfertigung für den Griff zu den „Gute-Nacht-Bier“-Flaschen kann ich gar nicht verspüren. Ist diese Todesangst normal, eine sogenannte Störung, muss ich darüber sprechen? Ich weiß es nicht – nur, dass es unerträglich ist. Dann lieber betäuben. Dass das nicht gut ist, versteht sich von selbst. Aber was will man machen – gerade wenn sich dann die Angewohnheit eingeschliffen hat. Geht alles weiter, muss ja. Augen zu und durch. Klingt so Suchterklärung? Wahrscheinlich.
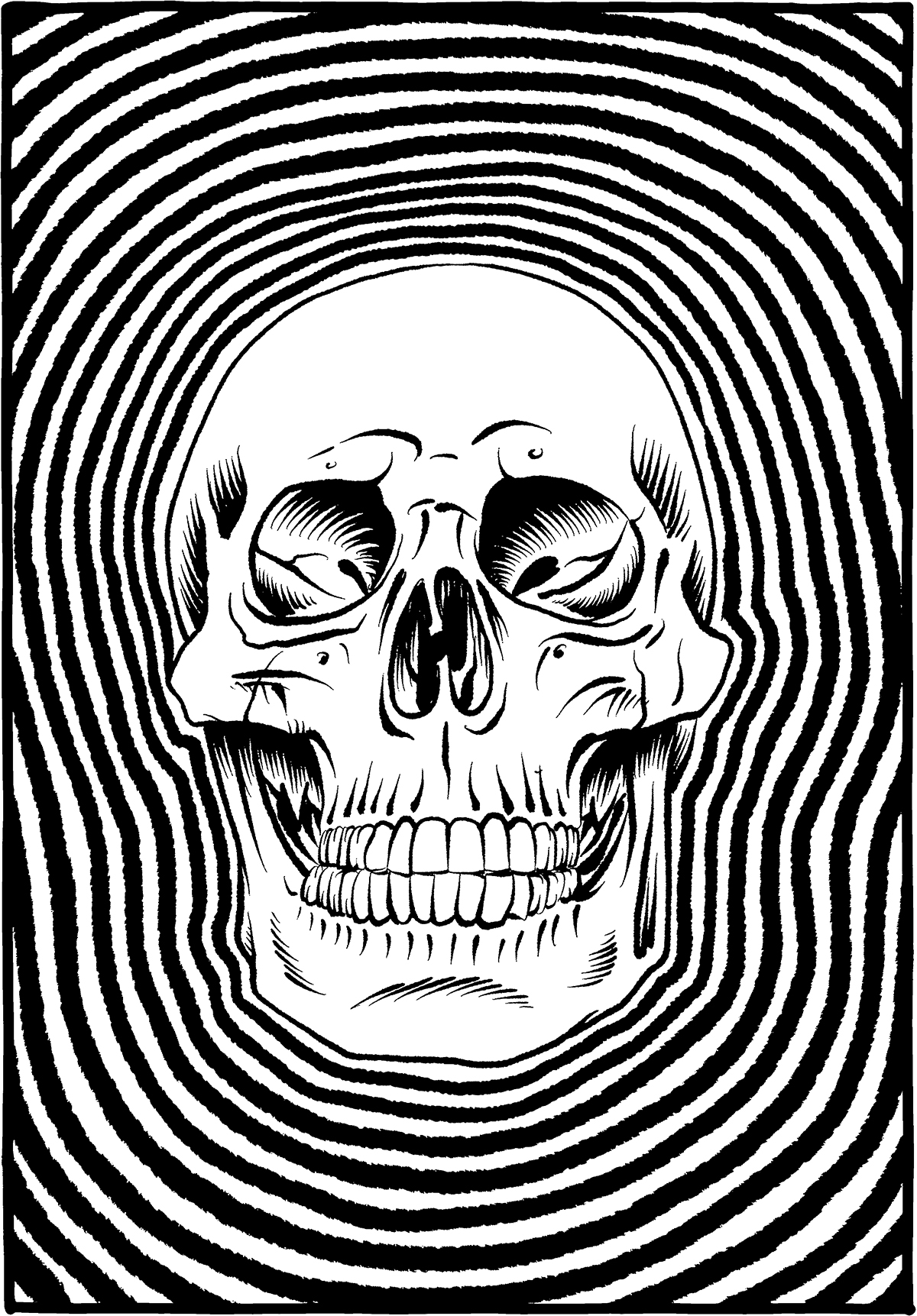
aus der Graphic Novel „Gevatter – Kapitel Eins: Verleugnung“
Ich habe mal versucht, mich dieser meiner Urangst zu stellen und für das Leipziger Stadtmagazin kreuzer eine Titelgeschichte geschrieben über Sterben und Tod. Auch diese Auseinandersetzung war unerträglich, aber aus professionellen Gründen – muss ja – gelang sie. Tröstlich war auch das nicht: „Αlpha und Omega. Anfang und Ende.“ „Hier kommen wir alle mal hin.“ Standesamtsleiter Uwe Bernhardt weist auf eine Regalfront. Sie gehört zum Sterberegister der Urkundenstelle. Hier werden die Namen der Verstorbenen, ihr Geburts- und ihr Todesdatum aufbewahrt. Der Raum im Erdgeschoss des Stadthauses misst circa sieben mal zwölf Meter. Von der weißen Kreuzdecke hängen vier Neonlampen herab, geben kaltes Licht auf graue Metallregale. Darin stehen schwarze gebundene Bücher und Stehsammler mit rosa Aktenmappen. Sie enthalten die Sterbeurkunden der in den letzten 30 Jahren Verstorbenen. „Es ist nicht viel, was am Ende übrig bleibt.“
Gut, ich war dann aufgeklärt über die letzten Dinge, habe mit Bestattern gesprochen etc. Geholfen hat mir das für die dunkelsten Stunden nicht. Dann kriecht einfach wieder diese Scheiß-Angst hoch. Da kann man noch so über Baudetails sinnieren oder sich an Gespräche mit professionellen Todesbegleitern erinnern. Das bleibt hilflose Geste. Alle Rationalisierung, etwa, dass das der natürliche Lauf der Dinge ist, kommt dem tiefen Angstgefühl nicht bei. Ja, wir werden alle sterben und viele haben Angst davor. Aber das nimmt mir nicht die Furcht vor dem Unvorstellbaren.
Logo: Der Tod bildet eine anthropologische Konstante. Wie alle anderen Lebewesen vergehen die Menschen irgendwann. Aber nur ihnen ist die Gewissheit des Todes eigen: Wir wissen, dass wir sterben müssen. Der Gedanke an das persönliche Ende, das Nicht-mehr-Sein bedrückt und beängstigend. Wir können ihn uns gar nicht vorstellen. Die eigene Nichtexistenz ist undenkbar, weil wir diese Betrachterposition unmöglich einnehmen können. Das muss doch zur puren physischen und psychischen Verzweiflung, zum Schmerz vor dem Undenkbaren führen. Wie mit der Angst vor der Leere umgehen? Keine Ahnung.
„Übe zu sterben“, lautete angeblich Platons letzte Sentenz. Das ist klug, aber hilft nicht. Dasein ist nach Martin Heidegger „Sein zum Tode“. Lol, gut zu wissen. Darauf muss man anstoßen. Daraus macht das Christentum die fromme Kunst zu sterben, die ars moriendi. Als ob das irgendwie erlernbar und der Tod damit überwindbar wäre. Das eigene Leben ist verfügbar, der Tod nicht. Er ist unerbittlich, total. Mit verschiedenen Sinnzusammenhängen haben Religion, Kultur und Philosophie versucht, dem Tod Bedeutung zuzuweisen. Aller metaphysischer Absicherung jedoch entkleidet, demütigt der Tod die Vernunft, macht das Bewusstsein der kommenden Bewusstseinslosigkeit irre. Keine Begegnung ist daher drastischer als das Sterben der anderen, der Freunde und Lieben. In die tiefe Trauer mischt sich ebenso tiefe Erschütterung. Und Schlaflosigkeit und der Hang zum Trank.
Meinen erwähnten Todesessay habe ich dann versucht, klug enden zu lassen: „Noch nicht! Wir können den Tod nicht verstehen, erfahren ihn als unbarmherzigen Fakt. Man kann von ihm nicht sprechen. Er ist ein leerer Begriff, unheimlich, ein Wort, das auf Nichts hinweist. Wir haben nur Krücken: Kultur ist für uns Überlebensleistung und die Lebensleistung des Menschen besteht darin, temporärer Überlebender zu sein. Sich dem Tod zu stellen, heißt, sich dem Leben zu stellen. Vom Tod sollten wir vielleicht etwas weniger schweigen, aber mehr noch über das Leben sprechen. Denn das bietet Gesprächsstoff genug.“
Das klingt reflektiert, einsichtig, beruhigend. Soll es auch. Nur mir hat das nicht geholfen. Intellektuell, vom Kopf her, kann ich das alles einsehen. Emotional nicht. Auf diese Gedanken geworfen, ja: Meistens nachts bleibt nur diese Scheißangst – und die „Gute-Nacht-Biere“.
„Nichts ist so fremd und finster wie der Hieb, der jeden fällt.“ Ernst Bloch
Dieser Text wurde erstveröffentlicht im Buch „Nicht gesellschaftsfähig – Alltag mit psychischen Belastungen“.






